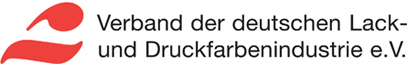Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) bildet seit 2006 den Kern des europäischen Chemikalienrechts. Mit dem Ziel, Mensch und Umwelt zu schützen und gleichzeitig eine funktionierende Industrie zu gewährleisten, gilt sie international als Vorbild für ein funktionierendes Chemikalienrecht. Bereits im Rahmen des Green Deal wurde eine Revision von REACH angestrebt, und nun – im Zuge des Clean Industrial Deal – wohl auch realisiert. Auf einer CARACAL-Sitzung (ein Treffen von Vertretern der Mitgliedsstaaten für REACH and CLP) Anfang April wurden die Eckpfeiler der als „zielgerichtete“ Revision angekündigten Überarbeitung präsentiert. Besonders für die Lack-, Farben- und Druckfarbenindustrie haben die diskutierten Maßnahmen potenziell weitreichende Auswirkungen.
Lacke & Farben aktuell
Zwischen Regulierung und Realitätscheck
„Mixture Allocation Factor“
Eine vieldiskutierte Änderung ist die Einführung eines „Mixture Allocation Factor“ (MAF). Ziel ist es, sogenannte Cocktail-Effekte – also die kombinierte Wirkung mehrerer Stoffe – besser in die Risikobewertung einzubeziehen. Bei allen Risikobewertungen von Chemikalien im Rahmen von REACH würde ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor angewendet, um diese Effekte zu berücksichtigen, und damit würde ein sehr seltener Effekt pauschal und undifferenziert bei einer riesigen Menge chemischer Stoffe formal angewendet. Das entbehrt einer notwendigen wissenschaftlichen Grundlage und bedeutet für die Farben-, Lack- und Druckfarbenindustrie, dass eine Vielzahl von Rezepturen umformuliert oder sogar wichtige Rohstoffe aufgegeben werden müssten.
„Gefahrenbasierter Ansatz“
Eine weitere Maßnahme, die bereits im Green Deal diskutiert wurde, ist die Ausweitung des „Gefahrenbasierten Ansatzes“ (GRA). Anders als beim risikobasierten Ansatz würde dabei nicht mehr die tatsächliche Exposition eines Stoffes berücksichtigt, sondern allein seine inhärente Gefährlichkeit. Während der GRA bislang auf CMR-Stoffe der Kategorie 1 beschränkt war, ist eine Ausweitung auf weitere Gefahrenklassen und auch auf Endverbraucheranwendungen im Gespräch. Dies käme einem pauschalen Verwendungsverbot für den privaten Endverbraucher gleich, ohne Berücksichtigung sozioökonomischer Folgen, realer Risiken oder möglicher Alternativen. Dies hätte etwa durch langwierige Substitutionsverfahren auch bei sicherer Anwendung oder den kompletten Wegfall von Verwendungen unverhältnismäßige Auswirkungen auf die Unternehmen.
„Essential Use Concept“
Eine weitere Maßnahme ist das sogenannte „Essential Use Concept“ (EUC). Dieses Konzept sieht vor, besonders besorgniserregende Stoffe nur dann weiter zuzulassen, wenn sie für eine essenzielle Funktion notwendig gelten und keine sichereren Alternativen existieren. In der praktischen Umsetzung ist kaum zu erwarten, dass ein solcher Mechanismus zu einer Vereinfachung oder Beschleunigung der Verfahren führt. Vielmehr könnten zusätzliche Komplexität und Unsicherheiten bei der Auswahl geeigneter Regulierungsinstrumente entstehen. Ob es Behörden und politischen Entscheidungsträgern gelingt, bei oft technisch anspruchsvollen Sachverhalten verlässlich zu bestimmen, welche Verwendungen als „essenziell“ gelten, ist fraglich.
Registrierung von Polymeren
Bislang besteht für Polymere keine umfassende Registrierungspflicht unter REACH. Im Rahmen der Revision sollen nun Polymere mit einem Herstell- oder Importvolumen von über einer Tonne pro Jahr erfasst werden, zunächst durch eine Notifizierung, später möglicherweise durch vollständige Registrierung. Dabei sollen bestimmte Kriterien zur Identifikation registrierungspflichtiger Polymere (Polymers Requiring Registration, PRR) herangezogen werden. Es steht zu befürchten, dass auch Farben- und Lackhersteller erstmals registrieren müssen. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass für den Verbraucher- und Umweltschutz bereits die bestehende Praxis der Charakterisierung von Polymeren über die Registrierung der sie konstituierenden Bausteine, die Monomere, ausreichend ist.
Weitere Maßnahmen werden bereits diskutiert
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen diskutiert, die vielleicht nicht direkt, wohl aber indirekt Auswirkungen haben können: So soll etwa die Gültigkeit einer Registrierung auf zehn Jahre begrenzt werden. Rohstoffhersteller müssen sich erneut registrieren oder die Registrierung verlängern, gegebenenfalls erneut (höhere) Gebühren entrichten und strengere Datenanforderungen erfüllen. Ferner soll auch die Möglichkeit eingeführt werden, eine erteilte Registrierung wieder zurückzuziehen. Dies birgt Unsicherheiten und höhere Kosten für die gesamte Lieferkette. Eine Revision der REACH-Verordnung bietet grundsätzlich die Chance, das Regelwerk zeitgemäß und zukunftsorientiert auszugestalten, gleichwohl war diese Präsentation der geplanten Änderungen für viele ernüchternd und bildet in keinem Fall die angekündigten Vereinfachungen und Verringerung der bürokratischen Belastung ab, zumindest nicht für die Unternehmen, die die Maßnahmen umsetzen müssen.
Kommentar
Modernisierung mit alten Konzepten?
Die REACH Revision wird Teil des „Chemicals Industry Package“ sein, welches „gezielte Initiativen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Modernisierung des Sektors sowie zur Förderung von Produktion und Innovation in Europa“ beinhalten soll. Die Kommission hat mit vielen Aussagen wie dieser große Erwartungen geweckt, was Vereinfachung, Bürokratieabbau und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit angeht. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als enttäuschend, dass die Pläne, welche im CARACAL Meeting vorgestellt wurden, sehr nah an dem sind, was in der letzten Amtszeit unter dem Green Deal und der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit vorgeschlagen worden war. Maßnahmen, die immense Auswirkungen auf die chemische Industrie und speziell auf Formulierer wie die Hersteller von Farben und Lacken hätten: eine verringerte Rohstoffbasis, eingeschränkte Innovationsfähigkeit, höhere regulatorische Belastungen und weitere Wettbewerbsnachteile gegenüber Produzenten außerhalb der EU. Die Vorschläge würden also sehr gezielt das Gegenteil von dem erreichen, was die EU-Kommission angekündigt hat. Es ist klar, dass ein Politikwechsel nicht immer gleichzeitig in allen Instanzen einer großen Organisation wirksam wird; gewisse Erhaltungstendenzen kennt man auch außerhalb der Politik und sind zu erwarten. Dennoch muss die Kommission hier sehr aufpassen, dass sie nicht ihre Glaubwürdigkeit verliert und den Anschein erweckt, dass reine Ankündigungspolitik betrieben wird. Der Kurswechsel kann nur gelingen, wenn auch die Arbeitsebene auf den neuen Kurs eingeschworen wird. Konsequenterweise gab es auch schon Signale aus der Kommission, dass die im CARACAL vorgestellten Pläne noch nicht die abschließende Meinung der EU-Kommission darstellen. Der VdL und seine Partner setzen sich dafür ein, dass das, was auf der großen politischen Bühne versprochen wurde, auch bei jeder konkreten Maßnahme umgesetzt wird. Dazu müssen in der Chemikalienpolitik die Konzepte aus der letzten Amtszeit grundlegend überdacht werden und nicht nur anders verpackt unter neuem Label vermarktet werden. Nur durch einen klaren Politikwechsel kann eine wirkliche Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden. Für REACH heißt das, dass in Bezug auf die bisher vorgestellten Pläne deutlich nachgebessert werden muss.
Kommentar von Dr. Christof Walter, Geschäftsführer des VdL

Aline Rommert
Technische Referentin für die Themen
Produktsicherheit, Chemikalienrecht,
Nanotechnologie und Sicherheitsdatenblätter
Tel.: 069 2556 1705
eMail: rommert@vci.de