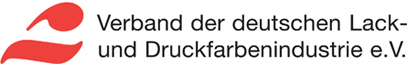Wenn Regulierung zur Belastung wird: Die Revision der CLP-Verordnung war Bestandteil der „Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit“ der Europäischen Kommission und ist am 10. Dezember 2024 in Kraft getreten. Mit ihr sollte die CLP-Verordnung unter anderem an die Globalisierung, die technologische Entwicklung und neue Verkaufsformen wie etwa Online-Marktplätze angepasst werden. In der Praxis ergeben sich erhebliche Mehrkosten, Mehraufwand und strukturelle Eingriffe.
Besondere Bedeutung für die Farben-, Lack- und Druckfarbenindustrie haben die Vorgaben zur Kennzeichnung, zu Werbung und Fernabsatz sowie die Umsetzungsfrist bei Neueinstufung durch den Vorlieferanten bzw. Rohstoffhersteller. VdL und auch CEPE haben sich im Prozess der Revision mit Nachdruck gegenüber Kommission, Parlament und Rat für praktikablere Lösungen eingesetzt – die verabschiedete Fassung bleibt dennoch mit erheblichen Belastungen für die Branche verbunden. In einem Workshop der EU-Kommission, der Mitte Mai stattfand und in dem die Praxisfähigkeit der neuen Regelungen diskutiert wurde, wurden von VdL, CEPE und vielen anderen europäischen Industrievertretern erneut die Argumente der Industrie eingebracht. Im Nachgang bestand nun die Möglichkeit für die Unternehmen, kurzfristig ihre besondere Betroffenheit zu kommunizieren, was viele VdL-Mitgliedsunternehmen genutzt haben. Da zahlreiche Firmen inzwischen mit der Umsetzung befasst sind, liegen nun belastbare Kostenschätzungen vor und bestätigen im Rückblick die berechtigten Bedenken, die VdL und CEPE frühzeitig kommuniziert haben.